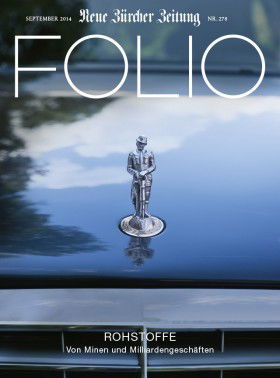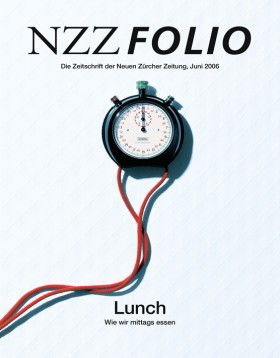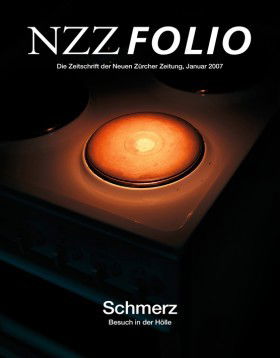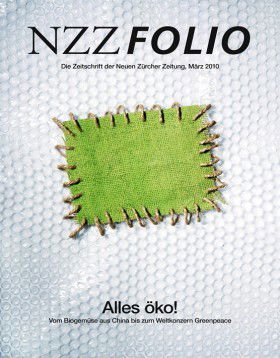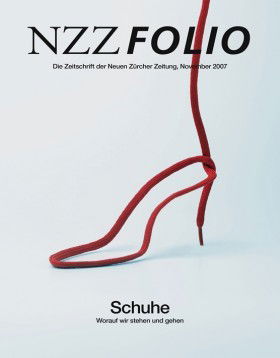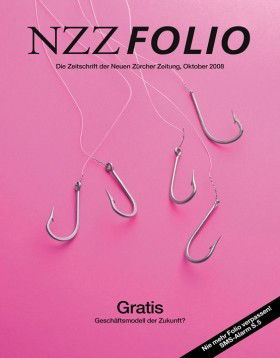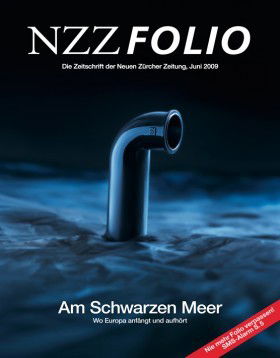Hier schaukeln die Gewinner. Mädchen mit polierten Lackschuhen und Umhängetäschchen von Prada werden von ihren Nannies behutsam in den Himmel geschubst. Man plaudert russisch, englisch oder französisch – das sind die Amtssprachen auf Zugs Spielplätzen. Zug ist nach Genf der wichtigste Rohstoffhandelsplatz der Schweiz. Die Wahrscheinlichkeit, ausserhalb des Sandkastens von einem Bentley oder Maserati überfahren zu werden, ist hier grösser, als dass ein Minenarbeiter in Kongo einen Lohn erhielte, der seine Familie ernährt.
Von Aluminium über Kaffee und Nickel bis Zink wird in der Schweiz alles gehandelt. 2013 war der hiesige Rohstoffhandelsumsatz zwanzigmal höher als noch im Jahr 2000. Die Branche ist mit schwindelerregenden Umsätzen zum wichtigen Schweizer Wirtschaftsfaktor geworden – mit entsprechendem Einfluss auf die Politik. Die setzt weltweit auf Wachstum und damit auf Wettbewerb, in dem Rohstoffe immer auch politisches Druckmittel sind. Eine Wirtschaftsstrategie, die auf einem massvollen Umgang mit Ressourcen basiert, ist uns noch immer fremd.
In Zug sind über 250 Firmen im Rohstoffhandel tätig. In Genf sind es 400. Als Kunst mag der Handel nicht erscheinen, eine Kunst ist es indes, in dieser Branche einen Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen. Zur Imagepolitur setzt manche Firma auf krisenfeste Pressesprecher, die selbst einer Ölkatastrophe noch etwas Gewinnendes abringen können.
Und so schaukeln wir sorgenfrei an den Gestaden schöner Seen. Die Mahnrufe der Experten verklingen als Echo in der Ferne: Verbrauchen wir weiter so viele Rohstoffe wie bisher, brauchen wir in 25 Jahren drei Erden. Gewinner gibt es dann keine mehr.